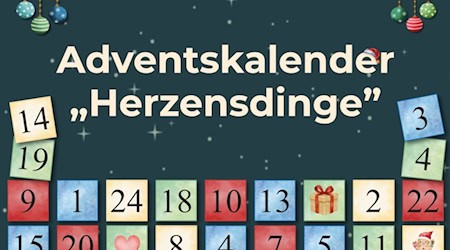Vor 15 Jahren hatte das Ehepaar Marianne und Jürgen Perl die Idee, eine Treuhandstiftung mit dem Namen „Zeit für ein Kind“ einzurichten. Beide hatten in ihrem langen Berufsleben als Psychologen tiefen Einblick in die Seele von Menschen, nicht zuletzt von Kindern. Beide waren so begeistert von dem gleichnamigen, seit 2001 bestehenden Mentoringprojekt der Bürgerstiftung Göttingen, dass sie einen Teil ihres Vermögens als finanziellen Grundstock in die Stiftung unter dem Dach der Bürgerstiftung gesteckt haben. Fast jährlich hat das Ehepaar den finanziellen Grundstock durch großzügige Zustiftungen kontinuierlich erhöht.
In dem seit fast 25 Jahren bestehenden Mentoringprojekt „Zeit für ein Kind“ der Bürgerstiftung Göttingen verbringen Kinder bis ca. 10 Jahren wöchentlich 2 bis drei Stunden mit erwachsenen Patinnen und Paten. Sie gestalten diese Zeit gemeinsam. Sie bewegen sich draußen, erzählen Geschichten, besuchen Veranstaltungen oder z.B. die Stadtbibliothek, entdecken Neues oder sind einfach nur zusammen. Diese regelmäßigen Treffen bieten den Kindern eine zusätzliche Bezugsperson, die ihnen Zeit schenkt, um ihre Persönlichkeit zu entfalten und ihr Selbstvertrauen zu stärken. Es geht darum, den Kindern eine schöne Zeit zu schenken.
Die Jubiläumsfeier wird am Dienstag, dem 3.Juni 2025, 18:00 Uhr in der Arnoldischule, Friedländer Weg 33 in Göttingen stattfinden.
Der Vortrag von Herrn Dr. Karl Gebauer, früherer Leiter der Leinebergschule sowie langjähriger Veranstalter des Göttinger Kongresses „Erziehung und Bildung“, wird den Festvortrag halten. „Zukunftschancen in unruhigen Zeiten?“ Der Vortrag richtet sich an Erzieher*innen, Lehrer*innen, Sozialpädagog*innen, Eltern, Großeltern, an Personen in politischer Verantwortung und andere Interessierte. Er wird wichtige Erziehungsfragen berühren, den Bezug zu gesellschaftlichen Entwicklungen herstellen und Lösungsansätze aufzeigen.
Jedem Menschen ist in seiner Kindheit eine liebevolle Zuwendung zu wünschen. Geschieht dies nicht und erfahren Kinder überwiegend Demütigungen und Gewalt, dann besteht die Gefahr, dass sie dieses Erlebnismodell in späteren Jahren reproduzieren – meistens zu Ungunsten anderer Menschen, die mit der Ursprungssituation nichts zu tun hatten. Das heißt, sie bringen andere Menschen in eine ähnliche Leidenssituation, der sie als Kinder hilflos ausgeliefert waren.
Hier sind die Ursachen für Hass, Demagogie, Destruktion und Zerstörung zu suchen. Diese Entwicklungsdynamik trifft vor allem dann zu, wenn Kinder mit ihren Gewalterfahrungen alleine gelassen wurden und wenn es in ihrer weiteren Entwicklung keinen Menschen gab, der ein auf Empathie basierendes Erfahrungsmodell vorleben konnte. Im Extremfall führen solche Erfahrungen zu Sympathie mit autoritären Systemen.
Es gilt, diese Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und zu verhindern. Hier liegt eine zentrale Aufgabe für Eltern und Menschen in sozialen Einrichtungen.
Wie Erzieher*innen und Lehrer*innen erfolgreich mit Gewaltsituationen umgehen können stellt unser Referent anhand vieler Beispiele dar. So ist im Verlauf von Mobbingsituationen zu beobachten, wie Diffamierungen, Unwahrheiten und Hassbotschaften ein solches Maß annehmen können, dass Opfer für sich keinen Ausweg mehr sehen können. Der Verlust der Würde, der in solchen Handlungen sichtbar wird, gefährdet nicht nur ein individuelles Leben, im gesellschaftlichen Zusammenhang führt er zur Zerstörung von Demokratien.
Wird allerdings die Dynamik einer Mobbingsituation angemessen bearbeitet, so werden die damit verbundenen Erfahrungen in den neuronalen Netzen des Gehirns als innere Arbeitsmodelle gespeichert. Beteiligte Personen verfügen dann über ein inneres Arbeitsmodell, das es ihnen ermöglicht, vor allem Lüge und Wahrheit in komplexen Prozessen zu unterscheiden. Solche Erfahrungen können Kraftquellen für das Leben sein und somit als Grundlagen für demokratisches Handeln angesehen werden.
Viele Wissenschaftler*innen, die sich mit diesem Problemfeld beschäftigen, sehen geradezu die Kernaufgabe menschlicher Bildung in der Entwicklung dieser Kompetenzen. Sie bilden die Grundlage für demokratisches Handeln und das kann vor allem in den vielen Konfliktsituationen, die es in der Kindheit gibt, gelernt werden. In Streitsituationen werden Gefühle wie Wut, Ärger, Ohnmacht erlebbar. Diese gilt es altersgemäß zu benennen und zu bearbeiten. Geben Erwachsene Hilfestellungen, dann findet eine emotional-kognitive Bearbeitung der Situation statt. Betroffene Kinder erleben, dass sie nicht nur Urheber von Streit sind, sondern dass sie auch zur Lösung beitragen können. Das stärkt ihr Selbstwertgefühl und es bilden sich Grundstrukturen für soziales und damit demokratisches Verhalten heraus. Rücksichtslosigkeit und brutale Ausübung von Macht würden in den Hintergrund treten - ein Gewinn für die Gesellschaften dieser Welt.
Anmeldung zur Veranstaltung bitte unter: lieske@buergerstiftung-goettingen.de